Spielfinger Wartesaal; 10. März 2002: Der Unterschied zwischen einer Metropole und einer Metropole in Ausbildung ist das Vorhandensein von Goldfingern in Funktion einer ganz normalen Kneipe, in der man sein Bier trinkt, weil man es dazu gerade mal ein bisschen plüschiger haben möchte.
In London oder Berlin trinkt man also in plüschiger Umgebung bei plüschiger Musik ein plüschiges Bier, weil einem das in diesem Moment so ein angenehm plüschiges Gefühl gibt Weshalb man eben heute da hingeht und nicht woanders.
*
In Frankfurt hingegen nimmt man eine Bar, in der ansonsten engagierte Frauen auf samtbezogenen Tischen mit rundumlaufender Kotzrinne tanzen und macht daraus ein temporäres Event.
Zum Wesen eines Events gehört allerdings, dass in dieser temporär zweckentfremdeten, eigenplüschigen Umgebung vollkommen unplüschige Musik aus einem Laptop läuft und/oder eine spezielle Performance vorgetragen wird, doch dazu später mehr.
Die Stimmung ist die eines Wartesaals. Die Anwesenden scheinen alle auf irgend etwas zu warten, was doch nie kommen wird.
Dadurch wird Kommunikation an sich bereits ausgeschlossen, da sie das aktive Warten unterbinden würde.
Man schaut erwartungsvoll in Richtung Tür oder auch mal in den Raum, doch auch die Neuankömmlinge gehen übergangslos in den Wartenden auf, werden von der Situation vollkommen assimiliert.
Der eine oder andere ist über diese verlängerte Adoleszenz des Wartenden erhaben, spricht kurz mit seinesgleichen (Diederichsen prägte 1985 der Begriff der "GroÃfreunde", ein Prinzip, das durchaus auch auf das Verhalten von Kunstschaffenden im Freigang anzuwenden ist) und entzieht sich schnell wieder dem Moment, sofern noch nicht die Grenze überschritten ist, die den Wartesaal in Plüsch wieder seiner eigentlichen Intention zurückführt: der einer urbanen Tränke mit den qualitativ unschlagbaren Argumenten:
Es ist laut, es sind Menschen, es gibt Bier.
*
Später wird die Zusammensetzung des Publikums kippen: mehr und mehr Menschen werden sich in somnambulen Akten einer auf intellektueller Ebene im nachhinein nicht reproduzierbaren Verbrüderung sinnlos betrinken, die einen, weil sie dazu gekommen sind, die anderen, weil sie beim Warten zu den einen geworden sind.
*
Die Musik ist elektronisch; klar, wie soll sie sonst sein, wenn sie aus einem Laptop kommt?
Auf gar keinen Fall plüschig. Das gehört zum Konzept.
Ein Mensch mit wirrem Haar, überdimensionierter Sonnenbrille und auffälligem Verhalten führt eine mehr oder weniger exotische kleine Trommel bei sich, auf die er ab und zu unvermitttelt und bar jeglichen Rhythmusgefühls einschlägt, um ebenso unvermittelt wieder damit aufzuhören, der eine oder andere Gast verhält sich konform und tut es ihm gleich.
Gehört die geschmackliche Provokation dieser Erscheinung zum Konzept? Sind die Betreiber dieses sich selbst auferlegten Prinzips des subkulturellen Wartesaals bereits so überdrüssig, dass sie diesen Trick anwenden, um das Publikum zum eigenmächtigen Aufgehen in der Situation zu motivieren? Jemand könnte doch endlich die Trommel ergreifen und damit auf den Sonnenbebrillten einschlagen!
Nein, der Chef kommt irgendwann und nimmt dem Wesen das Schlagwerk weg, um von diesem darauf hin zum hinteren Teil der Räumlichkeiten verfolgt zu werden. Der Vorgang entzieht sich der Wahrnehmung der Beobachter, die sich den Wartenden um sie herum insoweit angepasst haben, dass inzwischen auch sie nur noch darauf warten, dass irgend etwas passieren möge.
*
Doch es kam schlimmer. Plötzlich und unangekündigt bemüht sich eine weibliche Stimme zu erheben, die leise und unter heftigem Rückkopplungskreischen der erbarmenswert missbrauchten Technik anfängt, einen Text zu rezitieren.
Das Wort "Schwanz" kann erkannt werden, mehrmals, eine zerhackte Geschichte baut sich auf, um ebenso plötzlich wieder in heftiges elektronisches Geräusch überzugehen, beides im folgenden mehrmaligen Wechsel.
Nein, die Geschichte ist nicht wirklich gut, nicht einmal ansatzweise interessant; zerrissene Eindrücke, die den Zuhörer fragen machen, was ist diesem Menschen nur in seinem Leben zugestoÃen. Es ist so schlecht, dass ein wie auch immer geartetet Kunstanspruch selbst mit gröÃtem Wohlwollen nicht abgeleitet werden kann.
*
Die Frau, bewehrt mit dunkler Sonnenbrille und einer Schirmmütze, liest aus einem dicken Manuskript, und das ist das eigentlich Erschütternde bei der Sache. Niemand braucht dazu ein Manunskript.
Das Publikum reagiert von amüsiert bis genervt, die Klasse der Erhabenen unterhält sich derweil weiter, die Performance einfach ignorierend.
*
Die Vermutung drängt sich auf, dass die dilettantisch und mit weiteren Schwänzen bemalten Leinwände an den Wänden auch von der tragischen Person stammen könnten, die Frage im Raum unbeantwortet lassend, ob sie zur "normalen" Ausstattung des Lokals gehören oder eigens im Rahmen des Events appliziert wurden, um das Wesen des Lokals im ursprünglichen Sinne in der Ãbertreibung sichtbar zu machen und im Umgang mit der Frage an sich wieder zu diffundieren.
Vielleicht sollte es ja auch einfach nur cool und lustig sein.
Es bleiben viele Fragen offen, der Besucher nimmt ihren flüchtigen Eindruck mit auf den Heimweg; die Nachtluft spült die unbefriedigenden Reste des angebrochenen Abends hinweg und abstrahiert diese hegemoniale Problematik des urbanen Zwangs, ein solches Event auf Grund seiner bekannten, zeitlichen Begrenzung einer temporären Institution so intensiv und oft auszukosten, um das schale Gefühl zu betäuben, dass man dazu verdammt ist, in dieser niemals erwachsenen Stadt zu leben.
Freundlicherweise überlassen von braan.org
*
In Frankfurt hingegen nimmt man eine Bar, in der ansonsten engagierte Frauen auf samtbezogenen Tischen mit rundumlaufender Kotzrinne tanzen und macht daraus ein temporäres Event.
Zum Wesen eines Events gehört allerdings, dass in dieser temporär zweckentfremdeten, eigenplüschigen Umgebung vollkommen unplüschige Musik aus einem Laptop läuft und/oder eine spezielle Performance vorgetragen wird, doch dazu später mehr.
Die Stimmung ist die eines Wartesaals. Die Anwesenden scheinen alle auf irgend etwas zu warten, was doch nie kommen wird.
Dadurch wird Kommunikation an sich bereits ausgeschlossen, da sie das aktive Warten unterbinden würde.
Man schaut erwartungsvoll in Richtung Tür oder auch mal in den Raum, doch auch die Neuankömmlinge gehen übergangslos in den Wartenden auf, werden von der Situation vollkommen assimiliert.
Der eine oder andere ist über diese verlängerte Adoleszenz des Wartenden erhaben, spricht kurz mit seinesgleichen (Diederichsen prägte 1985 der Begriff der "GroÃfreunde", ein Prinzip, das durchaus auch auf das Verhalten von Kunstschaffenden im Freigang anzuwenden ist) und entzieht sich schnell wieder dem Moment, sofern noch nicht die Grenze überschritten ist, die den Wartesaal in Plüsch wieder seiner eigentlichen Intention zurückführt: der einer urbanen Tränke mit den qualitativ unschlagbaren Argumenten:
Es ist laut, es sind Menschen, es gibt Bier.
*
Später wird die Zusammensetzung des Publikums kippen: mehr und mehr Menschen werden sich in somnambulen Akten einer auf intellektueller Ebene im nachhinein nicht reproduzierbaren Verbrüderung sinnlos betrinken, die einen, weil sie dazu gekommen sind, die anderen, weil sie beim Warten zu den einen geworden sind.
*
Die Musik ist elektronisch; klar, wie soll sie sonst sein, wenn sie aus einem Laptop kommt?
Auf gar keinen Fall plüschig. Das gehört zum Konzept.
Ein Mensch mit wirrem Haar, überdimensionierter Sonnenbrille und auffälligem Verhalten führt eine mehr oder weniger exotische kleine Trommel bei sich, auf die er ab und zu unvermitttelt und bar jeglichen Rhythmusgefühls einschlägt, um ebenso unvermittelt wieder damit aufzuhören, der eine oder andere Gast verhält sich konform und tut es ihm gleich.
Gehört die geschmackliche Provokation dieser Erscheinung zum Konzept? Sind die Betreiber dieses sich selbst auferlegten Prinzips des subkulturellen Wartesaals bereits so überdrüssig, dass sie diesen Trick anwenden, um das Publikum zum eigenmächtigen Aufgehen in der Situation zu motivieren? Jemand könnte doch endlich die Trommel ergreifen und damit auf den Sonnenbebrillten einschlagen!
Nein, der Chef kommt irgendwann und nimmt dem Wesen das Schlagwerk weg, um von diesem darauf hin zum hinteren Teil der Räumlichkeiten verfolgt zu werden. Der Vorgang entzieht sich der Wahrnehmung der Beobachter, die sich den Wartenden um sie herum insoweit angepasst haben, dass inzwischen auch sie nur noch darauf warten, dass irgend etwas passieren möge.
*
Doch es kam schlimmer. Plötzlich und unangekündigt bemüht sich eine weibliche Stimme zu erheben, die leise und unter heftigem Rückkopplungskreischen der erbarmenswert missbrauchten Technik anfängt, einen Text zu rezitieren.
Das Wort "Schwanz" kann erkannt werden, mehrmals, eine zerhackte Geschichte baut sich auf, um ebenso plötzlich wieder in heftiges elektronisches Geräusch überzugehen, beides im folgenden mehrmaligen Wechsel.
Nein, die Geschichte ist nicht wirklich gut, nicht einmal ansatzweise interessant; zerrissene Eindrücke, die den Zuhörer fragen machen, was ist diesem Menschen nur in seinem Leben zugestoÃen. Es ist so schlecht, dass ein wie auch immer geartetet Kunstanspruch selbst mit gröÃtem Wohlwollen nicht abgeleitet werden kann.
*
Die Frau, bewehrt mit dunkler Sonnenbrille und einer Schirmmütze, liest aus einem dicken Manuskript, und das ist das eigentlich Erschütternde bei der Sache. Niemand braucht dazu ein Manunskript.
Das Publikum reagiert von amüsiert bis genervt, die Klasse der Erhabenen unterhält sich derweil weiter, die Performance einfach ignorierend.
*
Die Vermutung drängt sich auf, dass die dilettantisch und mit weiteren Schwänzen bemalten Leinwände an den Wänden auch von der tragischen Person stammen könnten, die Frage im Raum unbeantwortet lassend, ob sie zur "normalen" Ausstattung des Lokals gehören oder eigens im Rahmen des Events appliziert wurden, um das Wesen des Lokals im ursprünglichen Sinne in der Ãbertreibung sichtbar zu machen und im Umgang mit der Frage an sich wieder zu diffundieren.
Vielleicht sollte es ja auch einfach nur cool und lustig sein.
Es bleiben viele Fragen offen, der Besucher nimmt ihren flüchtigen Eindruck mit auf den Heimweg; die Nachtluft spült die unbefriedigenden Reste des angebrochenen Abends hinweg und abstrahiert diese hegemoniale Problematik des urbanen Zwangs, ein solches Event auf Grund seiner bekannten, zeitlichen Begrenzung einer temporären Institution so intensiv und oft auszukosten, um das schale Gefühl zu betäuben, dass man dazu verdammt ist, in dieser niemals erwachsenen Stadt zu leben.
Freundlicherweise überlassen von braan.org
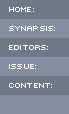
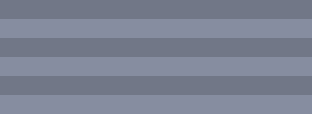
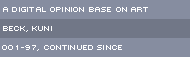
Schreibe einen Kommentar
Sorry, geht grad nicht.