Am zur√ľckliegenden Wochenende fand hier in Frankfurt unter dem Titel "Innenstadt AG" ein Koordinationstreffen zum Thema Innenstadt und innere Sicherheit statt. Als Nachfolgeveranstaltung zu dem im Oktober 96 in Berlin stattgefundenen "minus 96" kamen Gruppen und interessierte Menschen aus Hamburg, Berlin, Kassel, Bonn, K√∂ln, Frankfurt, M√ľnschen, Erlangen, N√ľrnberg und Z√ľrich.
Ziel des Treffens war zu
√ľberlegen, ob und wie eine gemeinsame Kampagne zu den Themen Rassismus, Drogenpolitik und innere Sicherheit im st√§dtischen Raum in ganz Deutschland (und der Schweiz) gestaltet werden k√∂nnte.
Ziel des Treffens war zu
√ľberlegen, ob und wie eine gemeinsame Kampagne zu den Themen Rassismus, Drogenpolitik und innere Sicherheit im st√§dtischen Raum in ganz Deutschland (und der Schweiz) gestaltet werden k√∂nnte.
Ich kann nicht √ľber das ganze Treffen berichten (dazu kommen vielleicht andere Stimmen und die gehaltenen Referate), m√∂chte aber einige Gedanken zu den Gespr√§chen in meiner Arbeitsgruppe mitteilen:
Anhand den Berichten √ľber die im September in Frankfurt stattgefundene Aktion "Wir kotzen auf die Zeil" wurde kritisiert, da√ü diese Aktion blo√ü "symbolisch" im Gegensatz von "pragmatisch" geblieben sei. "Pragmatisch" bedeute wirkliche Ver√§nderungen zu erreichen, wie z.B. Fl√ľchtlinge vor der Abschiebung zu bewahren. Abgesehen davon, da√ü solcherart von Interventionen unter den gegebenen Umst√§nden nur selten gelingen, empfinde ich eine Unterteilung in "symbolisch" und "pragmatisch" als √§u√üerst ungl√ľcklich, nicht blo√ü, weil sich da ein vermeintliches Richtig von Falsch zu scheiden droht, sondern, weil auch die Maschinerie von Repression und Unterdr√ľckung auch vielfach nur durch Symbolde wirkt, Uniformen, Befehlssprache, zeichenhafter und medialer Pr√§senz u.a. Gerade Sprache spielt hier eine wesentliche Rolle, wie sich, leider auch unter den Seminarteilnehmern, an der √úberbetonung von visuellen Erscheinungen ablesen l√§√üt. Da werden Menschen als "arabisch aussehend", als "Afrikaner" oder nur als "Schwarze" beschrieben, ohne einmal nachzufragen, welche Sprache diese Menschen √ľberhaupt sprechen. "Spechen sie Mbungu?" ist eine Frage, die wahrscheinlich hierzulande auf doppelte Verst√§ndnislosigkeit stie√üe; zum einen, weil kaum jemand weiss, wo Mbungu gesprochen wird (i.e. in Angola), zum anderen, weil die Relevanz Mbungu zu sprechen, von einigen "Schwarzen" abgesehen, in Deutschland keinerlei Stellenwert besitzen d√ľrfte.*** Damit wird zugleich das Problem einer Stellvertreterpolitik ber√ľhrt. Nach einigem Nachdenken konnten wir uns zwar daruf einigen, da√ü wir in keiner Stadt leben wollen, in der MigrantInnen und Fl√ľchlinge ausgegrenzt, vertrieben oder sicherheitsdienstlich behandelt werden, aber auf welche Weise wir uns ihnen denn n√§hern wollen, bleibt weiter unklar. Bis auf weiteres gilt: Man spricht Deutsch.
Problematisch blieb auch die Frage nach der Bedeutung von Innenstadt. Wollen wir √ľberhaupt dorthin, wo es doch schon so h√§√ülich dort ist.
F√ľr mich stellt das sich so da. Gerade im Zuge der in den 80ern begonnenen Musealisierung von Innenst√§dten (Shopping MAlls sind letztlich Museen entlehnt) erf√§hrt die Innenstadt eine erheblich Aufwertung als Speicher von Identit√§t und Geschichte, letztlich also von Macht. Das Thema Innenstadt hei√üt, wer hat die Macht, sich in den von ihr aufgespannten historischen, sozialen und kulturellen Raum einzuschreiben, nachdem sie als Aufzeichnungsmatrize entsprechend sensibilisiert wurde? (Die ganze Sicherheitsmaschinerie, Kameras etc, funktioniert ja wie ein Ged√§chnis.) Denn die Innenstadt wird ja gewollt so aufgezogen, so unverwechselbar gemacht (oder auch nicht, wenn St√§dt sich wie Sammler verhalten, die h√∂here Ebene sich "ihren" Foster, Gehry oder Koolhaas kaufen), da√ü sich eine bestimmte Gruppe von Menschen, Shopper, dort einschreiben kann. (Man h√∂rte das gequ√§lte Lamentieren als nach der Ausweitung der Ladenschlu√üzeiten der erhoffte Kaufrausch ausblieb.) Die Frage hei√üt demnach auch, will ich mich dort einschreiben, will ich meine eigenen Vorstellung von Einschreibung in die Innenstadt formulieren und in Konkurrenz zu anderen Arten von Einschreibung setzen?
Zuletzt kam noch die Frage auf, an wen sich eigentlich richten, wenn √Ėffentlichkeit nur noch Konsens √ľber den rassistischen Grundtenor von Stadtpolitik bedeute. Es mag zwar sein, da√ü die Medien gerne einen Konsens √ľber bestimmte Ma√ünahmen verbreiten wollen, aber damit ist √ľber seine Herstellung noch nicht viel ausgesagt. Zwar mag die Mehrheit der Bev√∂lkerung daf√ľr sein, da√ü "kriminelle ausl√§ndische Drogendealer" schnellstens ausgewiesen werden sollten, aber analog zu obigen Beispiel bin ich mir nicht so sicher, ob jeglicher Ugo-Sprecher sofort der Ausweisung √ľberstellt w√ľrde. Es kommt doch sehr auf die Art der Formulierung an, die den Leuten in den Mund gelegt wird. Und wie innerhalb des gegenw√§rtigen Szenario eines "Kampfes" (Verbrechens-be-k√§mpfung) den vermeintlich bek√§mpften Personen eine Subjektivit√§t zur√ľckgegeben werden kann, die die Gegenseit l√§ngst f√ľr sich in Anspruch genommen hat ("Braver Familienvater als Opfer ausl√§ndischer Gewalt"). Mit der Ausl√∂schung der gegnerischen Identit√§t schreibt sich ein Generalthema des 20. Jahrhunderts fort. Schon Ernst J√ľnger verk√ľndete 1930: "Nicht wof√ľr wir k√§mpfen ist wichtig, sondern, da√ü wir k√§mpfen."
-
***
Wie herbeigerufen, fand sich gestern, Montag, den 13.1.97 in der Frankfurter Rundschau ein Artikel zur französischen Sprachpolitik unter dem Titel "Warum Gott in Afrika französisch spricht."
Darin f√ľhrt der Autor Stefan Br√ľne vom Deutschen √úbersee-Institut in Hamburg folgendes aus:
Die Notwendigkeit franz√∂sisch zu sprechen und zu unterrichten war keineswegs von Anfang an Bestandteil der franz√∂sischen Kolonial- und Au√üenpolitik, sondern wurde bis zum zweiten Weltkrieg eher stiefm√ľtterlich behandelt. So gab es 1945 in franz√∂sisch beeinflu√üen Gebieten Afrikas nur 14.000 Grund- und 200 Sekundarsch√ľler. Das Bekenntnis zur Frankophonie als aktivem Bestandteil der kulturellen Au√üenpolitik setzte sich erst im Zuge der afrikanischen Unabh√§ngigkeitsbestrebungen und eher z√∂gerlich durch. √úberraschenderweise zeigten gerade die gerade von Frankreich abgefallenen Staaten ein gr√∂√üeres Interesse an der franz√∂sischen Sprache als die ehemalige Kolonialmacht selbst. Franz√∂sischer Unterricht und anderer Kulturtransfer mu√üte nachgerade eingefordert werden, als da√ü er selbst√§ndiger Teil franz√∂sischer Au√üenpolitik gewesen w√§re. Zur Verdeutlichung dieser Merkw√ľrdigkeit, die von Leopold Senghor, Senegal, dem Nestor der Frankophonie, angef√ľhrten Gr√ľnde das Franz√∂sische einheimischen afrikanischen Sprachen vorzuziehen: "(a) das reiche, pr√§zise, vernunftbezogene und abstrakte Vokabular, (b) ein durch 'keltische Leidenschaft' belebter Stil, der 'eine Symbiose aus griechischer Subtilit√§t und lateinischer Strenge' darstelle, (c) der franz√∂sische Humanismus und (d) eine Syntax, die das primitive Nebeneinander negro-afrikanischer Sprachen durch abstrakte und hierarchische Elemente √ľberwinde:'A la syntaxe de juxtaposition des langues n√©gro-africaines, s'oppose la syntaxe de subordination du fran√ßais; √† la syntaxe du concret v√©cu, celle de l'abstrait pens√©: pour tout dire, la syntaxe de la raison √† celle de l'√©motion.'" -- ganz erstaunlich diese Einsch√§tzung von einem "Afrikaner"; auch wenn der Autor, Br√ľne, nicht diesen expliziten Schlu√ü daraus zieht, so scheint es mir doch nahezuliegen, da√ü mit der Pr√§ferenz der Sprache der ehemaligen Herren schlie√ülich die eigene Position als Herrscher legitimiert werden soll; innerhalb des unvermeidlichen Kampfes um die Macht ist es gegebene Praxis statt aus den bestehenden Elementen (den einheimischen Stammessprachen) sich auf ein au√üen liegendes Element zu beziehen, um so √úberparteilichkeit zu demonstrieren. --
Den eigentlichen Aufschwung erlebte die Frankophonie erst in den 80er Jahren - erst 1986 wurde ihr ein eigenes Ministerium gegeben - vor dem Hintergrund des weltweiten Vordringen des Englischen als Verkehrssprache und der Angst vor der Bedeutungslosigkeit des Franz√∂sischen. Trotzdem verloren die vermehrten Anstrengungen (u.a. durch Gr√ľndung einer franz√∂sischsprachigen Verwaltungshochschule in Kairo und einem frankophonen Satelliten-Fernsehen) an Kraft durch die Frage, welches franz√∂sisch sprechende Land das Franz√∂sische am Besten vertrete. Weder Quebec, noch Belgien oder die Schweiz ware bereit die Vorherrschaft √ľber die Frankophonie umstandslos an Frankreich abzutreten. Dar√ľber hinaus besteht innerhalb aller frankophoner L√§nder keine Einigkeit √ľber die Natur der Frage, auf die die Frankophonie eine Antwort w√§re, so Stefan Br√ľne. Nach seiner Einsch√§tzung "deute vieles daraufhin, da√ü die Versuchung, die Frankophonie zur Sicherung von Kultur- und Diskurshoheit zu machen, als defensiver Reflex beschrieben werden m√ľsse ()"
Anhand den Berichten √ľber die im September in Frankfurt stattgefundene Aktion "Wir kotzen auf die Zeil" wurde kritisiert, da√ü diese Aktion blo√ü "symbolisch" im Gegensatz von "pragmatisch" geblieben sei. "Pragmatisch" bedeute wirkliche Ver√§nderungen zu erreichen, wie z.B. Fl√ľchtlinge vor der Abschiebung zu bewahren. Abgesehen davon, da√ü solcherart von Interventionen unter den gegebenen Umst√§nden nur selten gelingen, empfinde ich eine Unterteilung in "symbolisch" und "pragmatisch" als √§u√üerst ungl√ľcklich, nicht blo√ü, weil sich da ein vermeintliches Richtig von Falsch zu scheiden droht, sondern, weil auch die Maschinerie von Repression und Unterdr√ľckung auch vielfach nur durch Symbolde wirkt, Uniformen, Befehlssprache, zeichenhafter und medialer Pr√§senz u.a. Gerade Sprache spielt hier eine wesentliche Rolle, wie sich, leider auch unter den Seminarteilnehmern, an der √úberbetonung von visuellen Erscheinungen ablesen l√§√üt. Da werden Menschen als "arabisch aussehend", als "Afrikaner" oder nur als "Schwarze" beschrieben, ohne einmal nachzufragen, welche Sprache diese Menschen √ľberhaupt sprechen. "Spechen sie Mbungu?" ist eine Frage, die wahrscheinlich hierzulande auf doppelte Verst√§ndnislosigkeit stie√üe; zum einen, weil kaum jemand weiss, wo Mbungu gesprochen wird (i.e. in Angola), zum anderen, weil die Relevanz Mbungu zu sprechen, von einigen "Schwarzen" abgesehen, in Deutschland keinerlei Stellenwert besitzen d√ľrfte.*** Damit wird zugleich das Problem einer Stellvertreterpolitik ber√ľhrt. Nach einigem Nachdenken konnten wir uns zwar daruf einigen, da√ü wir in keiner Stadt leben wollen, in der MigrantInnen und Fl√ľchlinge ausgegrenzt, vertrieben oder sicherheitsdienstlich behandelt werden, aber auf welche Weise wir uns ihnen denn n√§hern wollen, bleibt weiter unklar. Bis auf weiteres gilt: Man spricht Deutsch.
Problematisch blieb auch die Frage nach der Bedeutung von Innenstadt. Wollen wir √ľberhaupt dorthin, wo es doch schon so h√§√ülich dort ist.
F√ľr mich stellt das sich so da. Gerade im Zuge der in den 80ern begonnenen Musealisierung von Innenst√§dten (Shopping MAlls sind letztlich Museen entlehnt) erf√§hrt die Innenstadt eine erheblich Aufwertung als Speicher von Identit√§t und Geschichte, letztlich also von Macht. Das Thema Innenstadt hei√üt, wer hat die Macht, sich in den von ihr aufgespannten historischen, sozialen und kulturellen Raum einzuschreiben, nachdem sie als Aufzeichnungsmatrize entsprechend sensibilisiert wurde? (Die ganze Sicherheitsmaschinerie, Kameras etc, funktioniert ja wie ein Ged√§chnis.) Denn die Innenstadt wird ja gewollt so aufgezogen, so unverwechselbar gemacht (oder auch nicht, wenn St√§dt sich wie Sammler verhalten, die h√∂here Ebene sich "ihren" Foster, Gehry oder Koolhaas kaufen), da√ü sich eine bestimmte Gruppe von Menschen, Shopper, dort einschreiben kann. (Man h√∂rte das gequ√§lte Lamentieren als nach der Ausweitung der Ladenschlu√üzeiten der erhoffte Kaufrausch ausblieb.) Die Frage hei√üt demnach auch, will ich mich dort einschreiben, will ich meine eigenen Vorstellung von Einschreibung in die Innenstadt formulieren und in Konkurrenz zu anderen Arten von Einschreibung setzen?
Zuletzt kam noch die Frage auf, an wen sich eigentlich richten, wenn √Ėffentlichkeit nur noch Konsens √ľber den rassistischen Grundtenor von Stadtpolitik bedeute. Es mag zwar sein, da√ü die Medien gerne einen Konsens √ľber bestimmte Ma√ünahmen verbreiten wollen, aber damit ist √ľber seine Herstellung noch nicht viel ausgesagt. Zwar mag die Mehrheit der Bev√∂lkerung daf√ľr sein, da√ü "kriminelle ausl√§ndische Drogendealer" schnellstens ausgewiesen werden sollten, aber analog zu obigen Beispiel bin ich mir nicht so sicher, ob jeglicher Ugo-Sprecher sofort der Ausweisung √ľberstellt w√ľrde. Es kommt doch sehr auf die Art der Formulierung an, die den Leuten in den Mund gelegt wird. Und wie innerhalb des gegenw√§rtigen Szenario eines "Kampfes" (Verbrechens-be-k√§mpfung) den vermeintlich bek√§mpften Personen eine Subjektivit√§t zur√ľckgegeben werden kann, die die Gegenseit l√§ngst f√ľr sich in Anspruch genommen hat ("Braver Familienvater als Opfer ausl√§ndischer Gewalt"). Mit der Ausl√∂schung der gegnerischen Identit√§t schreibt sich ein Generalthema des 20. Jahrhunderts fort. Schon Ernst J√ľnger verk√ľndete 1930: "Nicht wof√ľr wir k√§mpfen ist wichtig, sondern, da√ü wir k√§mpfen."
-
***
Wie herbeigerufen, fand sich gestern, Montag, den 13.1.97 in der Frankfurter Rundschau ein Artikel zur französischen Sprachpolitik unter dem Titel "Warum Gott in Afrika französisch spricht."
Darin f√ľhrt der Autor Stefan Br√ľne vom Deutschen √úbersee-Institut in Hamburg folgendes aus:
Die Notwendigkeit franz√∂sisch zu sprechen und zu unterrichten war keineswegs von Anfang an Bestandteil der franz√∂sischen Kolonial- und Au√üenpolitik, sondern wurde bis zum zweiten Weltkrieg eher stiefm√ľtterlich behandelt. So gab es 1945 in franz√∂sisch beeinflu√üen Gebieten Afrikas nur 14.000 Grund- und 200 Sekundarsch√ľler. Das Bekenntnis zur Frankophonie als aktivem Bestandteil der kulturellen Au√üenpolitik setzte sich erst im Zuge der afrikanischen Unabh√§ngigkeitsbestrebungen und eher z√∂gerlich durch. √úberraschenderweise zeigten gerade die gerade von Frankreich abgefallenen Staaten ein gr√∂√üeres Interesse an der franz√∂sischen Sprache als die ehemalige Kolonialmacht selbst. Franz√∂sischer Unterricht und anderer Kulturtransfer mu√üte nachgerade eingefordert werden, als da√ü er selbst√§ndiger Teil franz√∂sischer Au√üenpolitik gewesen w√§re. Zur Verdeutlichung dieser Merkw√ľrdigkeit, die von Leopold Senghor, Senegal, dem Nestor der Frankophonie, angef√ľhrten Gr√ľnde das Franz√∂sische einheimischen afrikanischen Sprachen vorzuziehen: "(a) das reiche, pr√§zise, vernunftbezogene und abstrakte Vokabular, (b) ein durch 'keltische Leidenschaft' belebter Stil, der 'eine Symbiose aus griechischer Subtilit√§t und lateinischer Strenge' darstelle, (c) der franz√∂sische Humanismus und (d) eine Syntax, die das primitive Nebeneinander negro-afrikanischer Sprachen durch abstrakte und hierarchische Elemente √ľberwinde:'A la syntaxe de juxtaposition des langues n√©gro-africaines, s'oppose la syntaxe de subordination du fran√ßais; √† la syntaxe du concret v√©cu, celle de l'abstrait pens√©: pour tout dire, la syntaxe de la raison √† celle de l'√©motion.'" -- ganz erstaunlich diese Einsch√§tzung von einem "Afrikaner"; auch wenn der Autor, Br√ľne, nicht diesen expliziten Schlu√ü daraus zieht, so scheint es mir doch nahezuliegen, da√ü mit der Pr√§ferenz der Sprache der ehemaligen Herren schlie√ülich die eigene Position als Herrscher legitimiert werden soll; innerhalb des unvermeidlichen Kampfes um die Macht ist es gegebene Praxis statt aus den bestehenden Elementen (den einheimischen Stammessprachen) sich auf ein au√üen liegendes Element zu beziehen, um so √úberparteilichkeit zu demonstrieren. --
Den eigentlichen Aufschwung erlebte die Frankophonie erst in den 80er Jahren - erst 1986 wurde ihr ein eigenes Ministerium gegeben - vor dem Hintergrund des weltweiten Vordringen des Englischen als Verkehrssprache und der Angst vor der Bedeutungslosigkeit des Franz√∂sischen. Trotzdem verloren die vermehrten Anstrengungen (u.a. durch Gr√ľndung einer franz√∂sischsprachigen Verwaltungshochschule in Kairo und einem frankophonen Satelliten-Fernsehen) an Kraft durch die Frage, welches franz√∂sisch sprechende Land das Franz√∂sische am Besten vertrete. Weder Quebec, noch Belgien oder die Schweiz ware bereit die Vorherrschaft √ľber die Frankophonie umstandslos an Frankreich abzutreten. Dar√ľber hinaus besteht innerhalb aller frankophoner L√§nder keine Einigkeit √ľber die Natur der Frage, auf die die Frankophonie eine Antwort w√§re, so Stefan Br√ľne. Nach seiner Einsch√§tzung "deute vieles daraufhin, da√ü die Versuchung, die Frankophonie zur Sicherung von Kultur- und Diskurshoheit zu machen, als defensiver Reflex beschrieben werden m√ľsse ()"
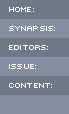
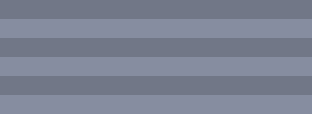
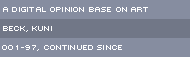
Schreibe einen Kommentar
Sorry, geht grad nicht.